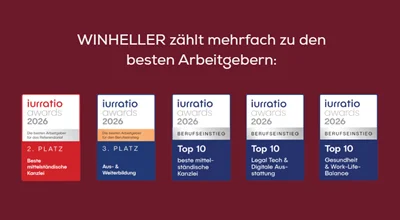KI-Systeme im Arbeitsrecht: Pflichten, Mitbestimmung, Gestaltungsmöglichkeiten
Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) verändert die Arbeitswelt in rasantem Tempo und eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten, insbesondere in den Personal- und Organisationsprozessen. Die KI kann eine Vielzahl repetitiver und zeitintensiver Aufgaben übernehmen:
-
automatisierte Vorauswahl von Bewerbungen
-
Verwaltung von Arbeits- und Fehlzeiten
-
Erstellung präziser und flexibler Schichtpläne
-
Performance-Management
Dadurch werden Mitarbeitende gezielt entlastet und Ressourcen effizienter genutzt.

KI unterstützt bei personalstrategische Entscheidungen
Vor allem in der Analyse und Auswertung großer Datenmengen bietet KI erhebliche Vorteile. Leistungswerte, Qualifikationen und Entwicklungspotenziale lassen sich umfassend und systematisch erfassen, um fundierte personalstrategische Entscheidungen zu treffen und individuelle Fördermaßnahmen passgenau zu gestalten. Das unterstützt nicht nur die fachliche und persönliche Entwicklung der Beschäftigten, sondern stärkt auch Motivation, Bindung und Leistungsbereitschaft.
Insbesondere im HR-Bereich eröffnet diese Technologie die Chance, Prozesse nicht nur schneller, sondern auch qualitativ hochwertiger zu gestalten. Entscheidungen können datenbasiert, konsistenter und weniger subjektiv ausfallen – sofern die eingesetzten Systeme korrekt und diskriminierungsfrei arbeiten. Unternehmen, die strategisch auf KI setzen, steigern nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit, sondern schaffen auch die Grundlage für eine zukunftsfähige und moderne Personalpolitik.
Welche arbeitsrechtlichen Herausforderungen und Pflichten ergeben sich beim Einsatz von KI?
Mit den Chancen gehen jedoch auch verpflichtende rechtliche Anforderungen einher. Die Europäische Union hat mit der KI-Verordnung (EU AI Act, VO 2024/1689) einen verbindlichen Rechtsrahmen geschaffen, der bis 2027 schrittweise wirksam wird. Diese Verordnung teilt KI-Systeme in unterschiedliche Risikoklassen ein. Systeme, die im Personalbereich eingesetzt werden – etwa zur Bewerberauswahl, Schichtplanung, Leistungsbewertung oder Entscheidungsunterstützung bei Gehalt und Beförderung – gelten häufig als sogenannte Hochrisiko-KI. Für diese gelten besonders strenge Auflagen, unter anderem zu Dokumentation, Überwachung, Transparenz und technischer Sicherheit.
Datenschutzkonformer Einsatz von KI-Systemen nach der DSGVO
Hinzu kommt, dass der Einsatz von KI im Unternehmen eine Vielzahl bestehender arbeitsrechtlicher Vorschriften berührt: So müssen nach der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) alle Verarbeitungen personenbezogener Daten und das betrifft in der Regel nahezu jede HR-KI rechtmäßig, zweckgebunden, transparent und sicher erfolgen. Das schließt die Pflicht mit ein, betroffene Mitarbeitende klar und verständlich darüber zu informieren, wenn ein KI-System ihre Daten nutzt oder ihre Arbeit beeinflusst. Ebenso muss offengelegt werden, welche Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck dies erfolgt und welche Auswirkungen zu erwarten sind.
Diskriminierungsverbot gemäß dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Ein weiteres arbeitsrechtlich zentrales Thema ist der Schutz vor Diskriminierung. KI kann unbewusst Vorurteile (sogenannte Bias) aus den Trainingsdaten übernehmen und diese bei Entscheidungen fortführen, etwa im Recruiting, bei Beförderungen oder bei leistungsabhängigen Zahlungen. Dies kann zu unzulässigen Benachteiligungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) führen und haftungsrechtliche Konsequenzen für das Unternehmen nach sich ziehen. Deshalb sind regelmäßige Überprüfungen, Audits und technische sowie organisatorische Maßnahmen erforderlich, um eine faire und diskriminierungsfreie Funktionsweise sicherzustellen.
Haftungsfragen beim Einsatz von KI-Systemen im Arbeitsrecht
Mit der zunehmenden Integration von KI-Systemen in den Arbeitsalltag stellt sich für Unternehmen eine zentrale Frage: Wer haftet, wenn die KI Fehler macht?
Die rechtliche Lage ist im deutschen Arbeitsrecht und nach aktueller EU-Regulierungskompetenz komplex, da spezielle gesetzliche Vorgaben zu KI-Haftung bislang nur punktuell existieren. Im Alltag kommen die allgemeinen haftungsrechtlichen Regeln nach BGB und Produkthaftungsgesetz zur Anwendung, mit einigen praxisrelevanten Besonderheiten. Es ist daher unerlässlich, dass Unternehmen klar regeln, wer in solchen Fällen die Verantwortung trägt, und sicherstellen, dass KI-gestützte Ergebnisse immer einer menschlichen Prüfung unterzogen werden. Auch die Schulung der Mitarbeitenden, die mit solchen Systemen arbeiten, ist gesetzlich geboten und in der Praxis unverzichtbar, um Fehlentscheidungen und Rechtsverstöße zu vermeiden.
Grundsätze: Wer haftet bei Nutzung von KI?
-
Die Verantwortlichkeit liegt beim Nutzer (gemäß KI-EU-Verordnung Betreiber) bzw. dem Unternehmen.
KI-Systeme besitzen keine Rechtspersönlichkeit, können also selbst nicht haften. Das Unternehmen, das die KI im Arbeitskontext einsetzt und deren Ergebnisse nutzt, bleibt stets primärer Haftungspartner. Etwa wenn eine mangelhafte KI automatisiert Bewerber diskriminiert oder fehlerhafte Dienstpläne erstellt. -
Haftung der Mitarbeitenden
Arbeitnehmer, die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit KI-Systemen arbeiten und dabei einen Schaden verursachen, unterliegen dem Grundsatz des innerbetrieblichen Schadensausgleichs. Sie haften nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, etwa wenn sie offensichtlich fehlerhafte KI-Ergebnisse ungeprüft übernehmen und daraus ein Schaden entsteht. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Arbeitgeber. -
Hersteller- und Entwicklerhaftung
Hersteller haften primär im Rahmen der etwaigen Produkthaftung, wenn die bereitgestellte KI mangelhaft ist oder fehlerhafte Sicherheitsmechanismen umfasst. Mit der neuen Produkthaftungsrichtlinie der EU sind KI-Systeme explizit als Softwareprodukte einbezogen, sodass Softwarehersteller für Schäden infolge von Produktfehlern, etwa aufgrund unterlassener Updates, haftbar gemacht werden können.
Was sind typische Haftungsrisiken beim Einsatz von KI im Personalkontext?
-
Falsche Personalentscheidungen durch fehlerhafte KI
Eine automatisierte Bewerberauswahl führt zu diskriminierenden Ergebnissen, weil die KI-Algorithmen auf fehlerhaften Trainingsdaten beruhen. Das betroffene Unternehmen haftet arbeitsrechtlich für den entstandenen Schaden (Schmerzensgeld, AGG-Ansprüche).
Praxis-Tipp: Empfohlen wird eine menschliche Überprüfung der KI-Vorschläge und regelmäßige Überwachung auf diskriminierende Strukturen. -
Schaden durch Fehlbedienung der KI durch Mitarbeitende
Ein Mitarbeiter übernimmt blind einen von der KI erstellten Schichtplan, der systematisch Ruhezeiten unterschreitet und damit gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt. Kommt es zu Arbeitsunfällen oder gesundheitlichen Problemen, kann eine Haftung entstehen. Das Unternehmen ist insbesondere haftpflichtig, wenn Mitarbeitenden keine ausreichenden Kontrollmöglichkeiten gegeben oder keine Schulungen angeboten wurden. -
Verletzung von Geschäftsgeheimnissen und Datenschutz
Beschäftigte geben sensible Daten in eine cloudbasierte, für Dritte zugängliche KI-Plattform ein. Kommt es zu Datenlecks oder unbefugter Nutzung, haftet das Unternehmen für Datenschutzverletzungen und ggf. den wirtschaftlichen Schaden. Auch der Mitarbeitende kann haftbar werden, sofern grobe Fahrlässigkeit vorliegt (z.B. bewusste Umgehung interner Richtlinien). -
Mangelhafte KI-Software/Dienstleistung
Löst eine fehlerhaft programmierte interne HR-KI falsche Kündigungsentscheidungen oder Gehaltsabrechnungen aus, sind sowohl der Arbeitgeber als Betreiber als auch – im Rahmen der Produkthaftung – der Softwarehersteller für daraus entstehende Schäden haftbar.
Rechtssichere KI-Nutzung lohnt sich
KI-Systeme bieten insbesondere im Personalbereich enorme Potenziale zur Effizienzsteigerung, Qualitätsverbesserung und strategischen Personalentwicklung. Gleichzeitig stellen sie Unternehmen vor komplexe rechtliche Aufgaben. Mit vorausschauender Planung, transparenter Kommunikation und konsequenter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lässt sich die Technologie nicht nur rechtssicher, sondern auch zum Vorteil aller Beteiligten nutzen; für mehr Effizienz, Fairness und Zukunftsfähigkeit.
Was wir für Sie in Sachen KI tun können
Wer die Vorteile und Chancen von KI nutzen möchte, sollte den Einsatz sorgfältig planen und alle rechtlichen Anforderungen von Anfang an berücksichtigen. Als Kanzlei unterstützen wir Sie dabei umfassend. Von der strategischen Beratung bis zur rechtssicheren Umsetzung:
- Entwicklung und Prüfung von KI-Strategien im Arbeits- und Personalbereich
- Erstellung und Verhandlung von Betriebsvereinbarungen, insbesondere Rahmenbetriebsvereinbarungen zu KI
- Überprüfung von bestehenden Betriebsvereinbarungen zum Einsatz von KI-Systemen
- Arbeitsrechtliche Prüfung geplanter oder bereits eingesetzter KI-Systeme
- Beratung zur Umsetzung der KI-EU-Verordnung und zur Einhaltung der DSGVO
Ihr Anwalt für KI im Arbeitsrecht
Wenn Sie arbeitsrechtliche Fragen zum Einsatz von KI-Systemen in Ihrem Unternehmen haben oder Unterstützung bei der rechtssicheren Gestaltung und Verhandlung von Betriebsvereinbarungen wünschen, sprechen Sie uns gerne an. Wir stehen Ihnen mit unserer Expertise beratend und gestaltend zur Seite.
Sie benötigen Unterstützung?
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! Häufig gestellte Fragen beantworten wir in unseren FAQs.
Oder rufen Sie uns an: +49 (0)69 76 75 77 85 29
Häufig gestellte Fragen zu KI im Arbeitsrecht
Welche KI-Anwendungen sind im Personalbereich besonders verbreitet?
Automatisierte Bewerbervorauswahl, Verwaltung von Arbeits- und Fehlzeiten, Erstellung von Schichtplänen und Performance-Management gehören zu den häufigsten KI-Einsatzgebieten.
Müssen auch kleinere KI-Tools wie ChatGPT rechtlich geprüft werden?
Ja, sobald personenbezogene Daten verarbeitet oder Arbeitsprozesse beeinflusst werden. Auch einfache KI-Tools können Datenschutz- und Haftungsrisiken auslösen.
Welche Informationspflichten haben Arbeitgeber bei KI-Einsatz?
Mitarbeitende müssen klar darüber informiert werden, welche Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck und welche Auswirkungen zu erwarten sind.
Was ist Bias bei KI-Systemen und warum ist es problematisch?
Bias sind unbewusste Vorurteile aus Trainingsdaten, die zu diskriminierenden Entscheidungen führen können - etwa bei Bewerbungen oder Beförderungen.
Wann können Mitarbeitende für KI-Fehler haftbar gemacht werden?
Nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, etwa wenn offensichtlich fehlerhafte KI-Ergebnisse ungeprüft übernommen werden. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Arbeitgeber.
Was sind konkrete Beispiele für KI-Haftungsrisiken im HR-Bereich?
Diskriminierende Bewerberauswahl, Schichtpläne mit Arbeitszeitgesetz-Verstößen, Datenlecks durch cloudbasierte KI und fehlerhafte Gehaltsabrechnungen.