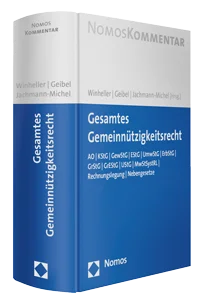Sponsoringvertrag
Was zeichnet einen guten Sponsoringvertrag aus?
Museen, Theater und insbesondere auch Sportvereine erzielen einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus dem Sponsoring. Die rechtliche Basis für das Sponsoring bilden Sponsoringverträge, die die unterschiedlichen Interessen der Sponsoren und der gemeinnützigen Organisationen in Einklang bringen sollen. Doch warum sollte ein Sponsoringvertrag stets schriftlich abgeschlossen werden? Welche zivilrechtlichen und steuerlichen Regelungen sollte ein guter Sponsoringvertrag enthalten? Welche Maßnahmen können Sponsoren und Organisationen im Falle von Krisen, Pandemien oder Naturkatastrophen ergreifen? Die Antwort auf diese Fragen finden Sie in diesem Beitrag.

Warum ist ein schriftlicher Sponsoringvertrag wichtig?
Vorab: Sponsoringverträge sollten nie mündlich, sondern stets schriftlich zwischen den Parteien abgeschlossen werden. Denn zum einen können die Vertragsparteien dem Finanzamt den schriftlichen Vertrag bei Nachfragen vorlegen und so ihre steuerliche Behandlung des Sponsorings belegen. Zum anderen helfen präzise formulierte Verträge nachträgliche Streitigkeiten zu vermeiden und schaffen Rechtssicherheit. Denn ohne Vertrag ist unklar, welche Regelungen gelten sollen: Für Sponsoringverhältnisse zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen existieren nämlich keine speziellen gesetzlichen Regelungen, auf die die Parteien für den Fall eines fehlenden Vertrags zurückgreifen könnten.
Gesamtkommentar Gemeinnützigkeitsrecht
Immer griffbereit: Erster Kommentar zum gesamten Gemeinnützigkeitsrecht, herausgegeben von Stefan Winheller (u.a.). Der erfolgreiche Querschnittskommentar widmet sich ausführlich und ausschließlich dem Steuerrecht gemeinnütziger Körperschaften.
Das Werk ist ideal für Juristen, Steuerberater, In-House-Counsel oder andere im Dritten Sektor Verantwortliche – denn er vereint sämtliche relevanten Normen der Einzelgesetze in einem Band.
Welche zivilrechtlichen Regelungen sollte ein guter Sponsoringvertrag enthalten?
Auf folgende Punkte sollten die Parteien bei der Formulierung ihres Sponsoringvertrags stets ein besonderes Augenmerk legen:
- Leistungspflichten: Der Sponsoringvertrag sollte eine klare Aufteilung der Leistungen und Gegenleistungen enthalten. Aus dem Vertrag muss daher zum einen hervorgehen, welche konkreten Werbeleistungen die Organisation erbringen soll (Trikotwerbung, Bandenwerbung etc.) und zum anderen welche Geld- oder Sachleistungen der Sponsor für die jeweiligen Werbeleistungen schuldet. Ferner sollte der Vertrag auch Angaben über die Dauer, Häufigkeit und Anzahl der Einzelleistungen sowie die Fälligkeit der Geld- und Sachleistungen enthalten. Die Parteien können zudem festlegen, dass sich das zu zahlende Entgelt bei Erreichung bestimmter Größen oder Erfolge, wie z.B. hohen Besucherzahlen oder der Gewinn einer Meisterschaft, erhöhen soll.
- Haftungsregelungen: Die Parteien müssen vertraglich klären, wer für den finanziellen Schaden aufkommt, wenn eine Veranstaltung ausfällt oder verschoben werden muss. Es ist dabei zulässig, dass die Haftung der Parteien auf einen Höchstbetrag beschränkt wird. Die Parteien können umgekehrt jedoch auch zusätzliche Vertragsstrafen festlegen, wenn eine Partei ihre Leistungspflicht nicht rechtzeitig oder ordnungsgemäß erfüllt. Die Parteien sollten zudem regeln, wer bei Unfällen im Rahmen von Veranstaltungen haftet bzw. dazu verpflichtet wird, eine entsprechende Versicherung abzuschließen.
- Vertragsdauer: Da es für Sponsoringverträge keine gesetzlichen Regelungen gibt, müssen die Parteien selbst festlegen, wie lange sie sich vertraglich binden möchten und wann sie ihre Zusammenarbeit beenden bzw. verlängern möchten. Der Vertrag muss daher Regelungen zur Laufzeit, zur (außer-)ordentlichen Kündigung sowie zu Verlängerungsoptionen enthalten. Eine Option zur Verlängerung des Vertrags ergibt beispielsweise Sinn, wenn der Sponsor sich vom sportlichen Erfolg eines Vereins (Aufstieg, Gewinn einer Meisterschaft) einen zusätzlichen Imagegewinn verspricht.
Welche steuerlichen Regelungen sollte ein guter Sponsoringvertrag enthalten?
Aus steuerlicher Sicht müssen die Parteien beachten, dass sie unterschiedliche Interessen verfolgen. Während der Sponsor regelmäßig einen Betriebsausgabenabzug für seine Geld- und Sachleistungen anstrebt, möchte die Organisationen die Zuwendungen möglichst steuerfrei vereinnahmen. Mit einem geeignetem Sponsoringkonzept können diese unterschiedlichen Interessen beider Parteien befriedigt werden. Dabei ist es wichtig, dass das Sponsoringkonzept durch passende vertragliche Regelungen flankiert wird. Um beispielsweise die Zuordnung der Leistungen zu den einzelnen Sphären der Organisation sicherzustellen, sind die einzelnen Leistungspflichten im Vertrag ausführlich zu beschreiben, voneinander abzugrenzen und der Wert jeder Leistung konkret zu beziffern. Diese detaillierte Leistungsaufteilung verhindert, dass das Finanzamt die einzelnen Leistungen als ein einheitliches Leistungsbündel behandelt und pauschal dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Betrieb zuordnet. Umgekehrt kann der Sponsor hierdurch seinen Betriebsausgabenabzug dem Grunde und der Höhe nach gegenüber dem Finanzamt belegen.
Sponsoring in Zeiten von Corona
Geisterspiele, Saisonabbrüche und abgesagte bzw. verschobene Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele in Tokio: Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass die meisten Sponsoren und Organisationen auch in rechtlicher Hinsicht nicht auf eine solche Ausnahmesituation vorbereitet waren. Der Grund: Viele Verträge enthielten keine sog. Force-Majeure-Klauseln, in denen die Vertragsparteien die Folgen von unvorhersehbaren und unvermeidlichen Ereignissen höherer Gewalt regeln können. Inhaltlich sehen diese Klauseln neben der temporären Suspendierung der gegenseitigen Leistungspflichten einen Ausschluss von Schadensersatzansprüchen vor und räumen den Parteien zudem umfangreiche Kündigungs-, Rücktritts- und Vertragsanpassungsrechte ein. Zwar enthält auch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) entsprechende Rechte. Zu beachten ist jedoch, dass das BGB keine Fälle von höherer Gewalt kennt, sondern nur gewöhnliche Fälle von Leistungsstörungen, sodass die Anwendung des BGBs im Einzelfall zu ungewollten Ergebnissen führen kann. Force-Majeure-Klauseln sind daher stets den gesetzlichen Regelungen vorzuziehen, da sie auf die individuelle Situation der Vertragsparteien abgestimmt sind und die Interessen beider Seiten angemessen berücksichtigen.
Zukünftige Sponsoringverträge: Nur mit Force-Majeure-Klausel
Nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch Naturkatastrophen und politische Krisen können dazu führen, dass Sponsoringleistungen nicht wie ursprünglich vereinbart erbracht werden können. NPOs und ihre Sponsoren sollten daher vor dem Abschluss eines neuen Sponsoringvertrags stets darauf achten, dass dieser eine Force-Majeure-Klausel enthält, die auf Augenhöhe verhandelt wurde und alle wesentlichen Umstände der Vertragsparteien berücksichtigt. Denn nur so lässt sich eine langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft, die für den Sponsoren mit einem positiven Imagetransfer und für die Organisation mit einer finanziellen Planungssicherheit verbunden ist, realisieren.
WINHELLER unterstützt Sie beim Thema Sponsoringverträge
Egal, ob Sie Fragen zu einzelnen rechtlichen und steuerlichen Aspekten eines Sponsoringvertrags haben oder Hilfe bei der Gestaltung ihres Sponsoringvertrages benötigen – unser breit aufgestelltes Team aus vor allem im Kunst-, Kultur- und Sportsponsoring erfahrenen Steuerberatern und Rechtsanwälten berät sowohl NPOs als auch Unternehmen in allen Fragen des Sponsoringrechts. Unser Leistungskatalog ist vielfältig und beinhaltet z.B.:
- Entwurf und Überarbeitung von Sponsoringverträgen in rechtlicher und steuerlicher Hinsicht
- Entwurf von Force-Majeure-Klauseln
- Steuerliche Überprüfung von Sponsoringpartnerschaften, insbesondere Umsatzsteuer und Ertragsteuer
- Gestaltungsberatung bei der Entwicklung von Sponsoringkonzepten
- Grenzüberschreitende rechtliche und steuerliche Beratung
- Implementierung von Compliance-Management-Systemen für NPOs, die sich intensiv über Sponsoring finanzieren
- Beratung und Vertretung in der Kommunikation mit den Finanzbehörden im Rahmen von Betriebsprüfungen und Einspruchsverfahren
- Steuerberatung, wie z.B. die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen.
Sie benötigen Unterstützung?
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! Häufig gestellte Fragen beantworten wir in unseren FAQs.
Oder rufen Sie uns an: +49 (0)69 76 75 77 85 24
Ihr Anwalt für Sponsoringverträge
Sie benötigen Hilfe bei der rechtlichen und/oder steuerlichen Gestaltung Ihres Sponsoringvertrags? Sie möchten eine Force-Majeure-Klausel in Ihren bestehenden oder zukünftigen Sponsoringvertrag aufnehmen? Sie sind sich unsicher über die steuerliche Einordnung von Sponsoringleistungen?
Melden Sie sich gerne bei uns. Ihre Ansprechpartner bei uns erreichen Sie am besten per E-Mail (info@winheller.com) oder telefonisch (069 / 76 75 77 85 24).