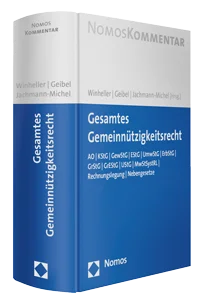Haftung in der Stiftung
Anwaltliche Beratung für Stiftungsvorstand und Kuratorium
Das deutsche Recht geht von einem einfachen Grundsatz aus: Wer schuldhaft seine Pflichten verletzt und einem anderen einen Schaden verursacht, muss dafür einstehen und dem Geschädigten den Schaden in Form von Schadensersatz ausgleichen.
Wer Fehler macht, muss dafür einstehen
Im Tagesgeschäft einer Stiftung haben die Stiftungsverantwortlichen vielfältige Möglichkeiten, schadensverursachende Fehler zu begehen. Entsprechend hoch sind die Haftungsrisiken. Und „Unkenntnis schützt vor Strafe nicht“. Wer nicht über die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, sollte also die Finger von einer Tätigkeit als Organ in einer Stiftung lassen. Denn der Schadensverursacher haftet grundsätzlich unbeschränkt mit seinem gesamten Privatvermögen.

Haftungsrisiken je nach Art der Stiftung und Umfang der Tätigkeit
Haftung ist aber nicht gleich Haftung. In kleinen unselbstständigen Stiftungen mit einem geringen Vermögen ist das Haftungsrisiko im Fall von Vermögenseinbußen deutlich niedriger als bei einer selbstständigen Stiftung mit einem hohen dreistelligen Millionenvermögen. Großveranstaltungen einer operativ tätigen Stiftung bergen höhere Risiken als kleinvolumige Fördermaßnahmen. Auch Mittelweiterleitungen im siebenstelligen Umfang ins Ausland sind riskanter als die lokale Förderung eines alteingesessenen deutschen Vereins mit jährlich 10.000 Euro.
Innenhaftung der Stiftung
Als Innenhaftung bezeichnet man die Haftung von Stiftungsorganen ihrer eigenen Stiftung gegenüber. Folgende Fehler ziehen typischerweise eine Innenhaftung nach sich:
- Fehler in der laufenden Geschäftsführung, z.B. weil ein Vorstandsmitglied einen für die Stiftung ungünstigen Vertrag abschließt oder weil die Stiftung aufgrund des Handelns des Vorstands die Gemeinnützigkeit verliert und Steuernachzahlungen ins Haus stehen
- Fehler des Vorstands in der Vermögensbewirtschaftung, wenn ein Teil des Vermögens der Stiftung daraufhin verloren geht
- Bußgeld gegen die Stiftung, z.B. wegen mangelnder Compliance
- Nicht ordnungsgemäße Auswahl, Ein- oder Unterweisung sowie Überwachung von Mitarbeitern
- Fehlerhafte Arbeits- und Ablauforganisation
- Verletzung der Insolvenzantragspflicht (Insolvenzverschleppung), selbst wenn ein Vorstandsmitglied tatsächlich keine Kenntnis von der schlechten wirtschaftlichen Lage der Stiftung hat
- Unterlassene Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen bis hin zum Sozialversicherungsbetrug
- Die wiederholte Beauftragung von sog. Scheinselbständigen ohne vorherige Durchführung eines Statusfeststellungsverfahrens
- Mangelhafte Rechnungslegung und Verletzung der steuerlichen Pflichten, d.h. insbesondere unterlassene Abführung der Steuern und/oder fehlende Überwachung und nicht ordnungsgemäße Zuarbeit bei Beauftragung eines externen Steuerberaters
- Fehlerhafter Umgang mit Spendenbescheinigungen (sog. Ausstellerhaftung und Veranlasserhaftung), z.B. Ausstellung falscher Zuwendungsbestätigungen oder eine zweckfremde Verwendung erhaltener Spenden
- Verstöße gegen die Loyalitätspflicht der Stiftung gegenüber, z.B. in Fällen von Interessenkollisionen
- Entscheidungen auf Grundlage nicht ausreichender Informationen oder basierend auf sachfremden Erwägungen und nicht im alleinigen Interesse der Stiftung
Außenhaftung von Stiftungsorganen
Die Stiftungsorgane können auch Dritten gegenüber haften, also Außenstehenden. Man spricht dann von Außenhaftung. Am häufigsten kommt dies in
- insolvenzrechtlichen,
- sozialversicherungsrechtlichen und
- steuerrechtlichen
Fällen vor. Der Stiftungsvorstand haftet z.B. dem Finanzamt gegenüber neben der Stiftung für die rechtzeitige und ordnungsgemäße Abgabe von Steuererklärungen sowie für die Entrichtung der Steuern. Vergleichbares gilt für die Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen.
Von diesen sehr praxisrelevanten Fällen abgesehen, sind Fälle, in denen ein Organmitglied Dritten gegenüber haftet, glücklicherweise eher selten. Ein Vorstandsmitglied einer Umweltschutzstiftung, das auf einer Veranstaltung zum Boykott eines Chemieunternehmens aufruft, könnte z.B. für den dadurch verursachten Schaden in Anspruch genommen werden. Verletzt sich bei einer Stiftungsveranstaltung ein Zuschauer oder Teilnehmer, stolpert z.B. ein Gast eines Charitydinners über ein falsch verlegtes Verlängerungskabel und verletzt sich und ist der Vorstand für die Durchführung der Veranstaltung verantwortlich gewesen, haftet der Vorstand wegen der Verletzung einer sog. Verkehrssicherungspflicht. Daneben haftet dem Geschädigten auch die Stiftung selbst.
Gesamtkommentar Gemeinnützigkeitsrecht
Immer griffbereit: Erster Kommentar zum gesamten Gemeinnützigkeitsrecht, herausgegeben von Stefan Winheller (u.a.). Der erfolgreiche Querschnittskommentar widmet sich ausführlich und ausschließlich dem Steuerrecht gemeinnütziger Körperschaften.
Das Werk ist ideal für Juristen, Steuerberater, In-House-Counsel oder andere im Dritten Sektor Verantwortliche – denn er vereint sämtliche relevanten Normen der Einzelgesetze in einem Band.
Haftung des Stiftungsvorstandes
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte der Stiftung und vertritt sie nach außen. Sein Haftungsrisiko ist daher verglichen mit dem des Kuratoriums bzw. Stiftungsrates deutlich höher.
Haftung des Kuratoriums/Stiftungsrates
Nur selten dürfte auch einmal ein Kuratorium einer Stiftung Haftungsansprüchen ausgesetzt sein. Weist beispielsweise ein Kuratorium den Vorstand an, rechtswidrige Maßnahmen zu ergreifen, die Dritte schädigen, kommt auch eine Haftung des Kuratoriums in Betracht.
Haftung der Stiftungsorgane als Gesamtschuldner
Sind mehrere Stiftungsorgane für einen Schaden verantwortlich, haften sie als sog. Gesamtschuldner, d.h. die Stiftung oder der Dritte kann von jedem der Verantwortlichen den Schaden ersetzt verlangen – aber natürlich der Höhe nach insgesamt nur einmal. Nach Ausgleich des Schadens kann das Stiftungsorgan, das den Schaden beglichen hat, von den anderen betroffenen Stiftungsorganen einen Ausgleich verlangen.
Stiftungsorgane | Haftungsrisiko und Schadensersatzpflicht
Durchsetzung von Ansprüchen der Stiftung
In Fällen der Innenhaftung zeigt sich in der Praxis häufig ein Defizit, wenn Ansprüche innerhalb der Stiftung aus – falsch verstandener – Rücksichtnahme den Kollegen gegenüber nicht durchgesetzt werden. Ein solches Vorgehen ist gefährlich: Ansprüche, die offenkundig sind und nicht geltend gemacht werden, gefährden bei gemeinnützigen Stiftungen nämlich zum einen die Gemeinnützigkeit, zum anderen ist das schuldhafte Unterlassen der Durchsetzung von Ansprüchen wiederum per se eine eigene Pflichtverletzung, die zum Schadensersatz führen kann.
Mit anderen Worten: Wäre ein Vorstand wegen eines ihm unterlaufenen Fehlers zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, verzichtet aber das Kuratorium ohne weitere Begründung darauf, den Schadensersatzanspruch durchzusetzen, wird schlussendlich das Kuratorium „die Zeche zahlen müssen“ – und die Gemeinnützigkeit ist im Zweifel trotzdem verloren.
Business Judgement Rule hilft Stiftungsvorständen
Stiftungsorgane müssen vielfältige Entscheidungen treffen. Oft werden sich die getroffenen Entscheidungen im Nachhinein als falsch herausstellen. Würde das Organ für jede dieser Fehlentscheidungen persönlich haften müssen, wäre es unmöglich, ein Amt als Stiftungsorgan auszuüben.
Trotz Fehlentscheidung verletzt ein Stiftungsorgan daher nicht seine Pflichten, wenn eine Ermessensentscheidung auf einer angemessenen Informationsgrundlage zum Wohle der Stiftung getroffen wurde (sog. Business Judgement Rule). Das ist dann der Fall, wenn die Entscheidung objektiv ist und allein im Interesse der Stiftung liegt. Persönliche Interessen des Stiftungsorgans oder sonstige sachfremde Erwägungen dürfen nicht maßgeblich für die Entscheidung sein.
Es kommt dabei übrigens auf den Zeitpunkt der Entscheidungsfindung an, nicht auf den späteren Zeitpunkt, zu dem sich herausgestellt hat, dass die Entscheidung tatsächlich ungünstig oder falsch war.
Sie benötigen Unterstützung?
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! Häufig gestellte Fragen beantworten wir in unseren FAQs.
Oder rufen Sie uns an: +49 (0)69 76 75 77 80
Was wir für Sie tun können
- Wir beraten Ihre Stiftung dabei, „compliant“ zu sein, d.h. möglichst keine rechtlichen Fehler zu begehen. Dann kommt es auch zu keiner Haftung.
- Eine gute Beratung, die Compliancerisiken reduzieren will, setzt voraus, dass wir die im konkreten Einzelfall bestehenden individuellen Haftungsrisiken sorgfältig analysieren. Bei jeder Stiftung stehen andere Haftungsrisiken im Vordergrund.
- Wir helfen Ihnen auch als Organmitglied, Ihre persönliche Haftung zu begrenzen. Haftungsbeschränkende Satzungsregelungen oder auch klare Ressortzuständigkeiten können ein probates Mittel dafür sein. Gleiches gilt für eine ordnungsgemäße Dokumentation von Entscheidungsprozessen.
- Wir beraten Sie zu den speziell für ehrenamtlich Engagierte geltenden gesetzlichen Haftungsbegrenzungen (z.B. keine Haftung für einfache Fahrlässigkeit).
- Wir setzen Schadensersatzansprüche, die auf schuldhafte Pflichtverletzungen von Stiftungsorganen zurückgehen, für Sie durch – außergerichtlich und, wenn nötig, vor Gericht.
- Wir beraten Sie zu sinnvollem Versicherungsschutz für Organmitglieder (D&O-Versicherungen).
- Wir beraten rechtlich und steuerlich zum Vermögensmanagement in Stiftungen – einem häufigen Haftungsgrund vor allem für Stiftungsvorstände.
Ihr Anwalt für Fragen der Stiftungshaftung
Sie wollen die Haftungsrisiken in Ihrer Stiftung reduzieren oder sich zu einem drohenden oder bereits eingetretenen Haftungsfall beraten lassen? Unsere Experten für Haftungsfragen in Stiftungen beraten Sie gern.
Melden Sie sich einfach telefonisch unter 069 76 75 77 85 24 oder per E-Mail unter info@winheller.com. Wir freuen uns auf Sie!